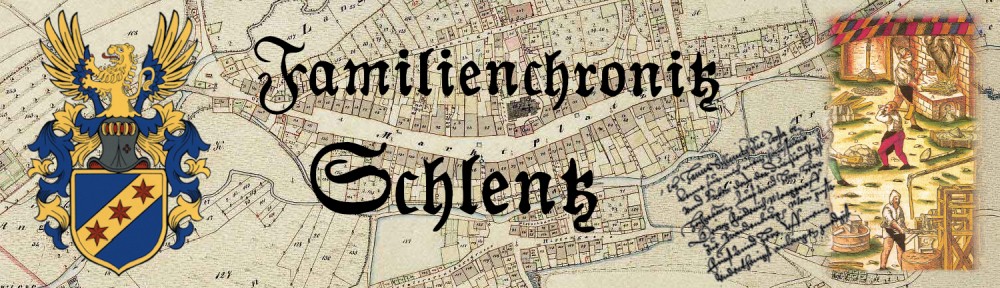Ottmannsreuth, seinerzeit ein Weiler im burggräflichen Amt Creußen inmitten einer Rodungsinsel im Forst Thiergarten, wurde erstmals im Jahr 1404 urkundlich erwähnt. Damals waren die Kindsberger (in anderer Schreibweise auch Künsberger) in und um Creußen herum sehr einflussreich.
Rittergeschlecht Kindsberg / Künsberg
Die von Kindsberg / Künsberg waren ein angesehenes oberfränkisches Rittergeschlecht (um 1220 Burg Kindesberg bei Creußen, um 1217 Schloss Kindsberg im Egerland). Noch heute sind mehrere Schlösser im Familienbesitz. Das Wappen der Gemeinde Emtmannsberg erinnert ebenfalls an diese Familie: Emtmannsberg (früher: Rentmannsberg) war seit Beginn des 13. Jahrhunderts im Besitz einer Kindsberger Seitenlinie.
Im ausgehenden 14. Jahrhundert hatten die beiden Brüder Georg I. von Kindsberg und Friedrich II. von Kindsberg Besitzungen in Ottmannsreuth. Am 23. April 1448 verkauften deren Nachfahren Adrian und sein Bruder Rüdiger von Kindsberg zu Schnabelwaid ihre Güter in Ottmannsreuth an das Bayreuther Spital.
Hospitalstift Bayreuth
Das Bürgerspital bzw. Hospitalstift wurde erstmalig im Jahr 1398 im Bayreuther Landbuch erwähnt. Der Bundesverband Deutscher Stiftungen nennt 1431 als die erste urkundliche Erwähnung. Stifter waren die Burggrafen von Nürnberg, die damaligen Stadtherren von Bayreuth sowie späteren Markgrafen von Brandenburg. Im Bürgerspital fanden damals arme, kranke und alte Menschen Aufnahme und Hilfe. Namenspatronin von Spital und zugehöriger Kirche war die Heilige Elisabeth von Thüringen (1207-1231). Die noch heute zum Hospitalstift gehörige barocke Spitalkirche St. Elisabeth ist seit der Barockzeit eines der berühmtesten Bauwerke in Bayreuth. Ab 1975 wurde das ehemalige Spitalgebäude als Studentenwohnheim genutzt, seit 2019 entstehen dort Stadtwohnungen.

Im Jahr 1448 kaufte das Bürgerspital von den von Kindsberg Güter zu Ottmannsreuth für 130 fl. rhn. Der Besitz des Spitals ist im Landbuch von 1499 dokumentiert:
Ottmarsreutt
Landbuch des Amtes Bayreuth von 1499
Item doselbst sind vier hoff unnd II seldenn [kleines Bauernhaus], sind des spitals zw Bayerreut, dartzw wismat [Wiesen], feldt unnd holtz, gehort alles aneinander gelegen. Uff dem allen hat die herschaft das halsgericht unnd alle furstliche obrigkeit unnd gehort inn das ambt Creusenn.
Lange mussten die Ottmannsreuther Hospitalhintersassen mit Pferden fronen (Spanndienste). Im Juni 1680 einigte sich das Stift mit den Ottmannsreuthern auf den vier Zinshöfen und zwei Sölden auf neue Frondienste: Künftig sollten sie jährlich insgesamt zehn Klafter Brennholz schlagen und dreißig Klafter in das Hospital nach Bayreuth per Anspann fahren (1 Klafter = 3 Ster). Dennoch waren auch weiterhin unregelmäßig Fronfuhren festgelegt: Getreidetransporte, Hilfe beim Bau des Militätlazaretts, Salpeterfuhren, Transport von Baumaterial usw. Erst seit den Bauernaufständen vom März 1848 und dem Grundentlastungsgesetzt vom Juni 1848 gehörten Frondienste der Vergangenheit an.
Ottmannsreuth im 19. Jahrhundert
Ab etwa 1800 gehörte Ottmannsreuth dann zur selbstständig gewordenen Landgemeinde Wolfsbach, pfarrte aber weiterhin nach Creußen (6,5 km Fußweg!). Eine Fundstelle aus dem Jahr 1801 zeigt, dass Ottmannsreuth über die Zeit hinweg nicht sehr stark gewachsen war:

Die bayerische Uraufnahme, die von 1808 bis 1864 erstellt wurde, zeigt den Standort und den Landbesitz der sechs Höfe. Die damaligen Hausnummern gelten noch heute.
Die Bahnstrecke Nürnberg-Bayreuth wurde 1877 eröffnet. Nächstgelegener Halt war Neuenreuth.
Die nächstgelegene Volksschule lag in Emtmannsberg(!). Der lange und insbesondere im Winter sehr beschwerliche Schulweg verlief vom unteren Weiher zur Brücke über den Main, von dort über …
Deutscher Bruderkrieg von 1866
Nach immer stärker gewordenen Spannungen erklärte Preußen im Jahre 1866 Österreich den Krieg und trat aus dem Deutschen Bund aus. In dem nur wenige Wochen dauernden Konflikt starben 60.000 Soldaten. In der kriegsentscheidenden Schlacht bei Königgrätz standen sich 400.000 Soldaten gegenüber; Preußen gewann auf ganzer Linie.

Am 28. Juli 1866 besetzten die Preußen Bayreuth und danach Nürnberg und Erlangen. Bayreuth hatte von 1791 bis 1805 zu Preußen gehört, daher hoffte die Bevölkerung auf eine milde Behandlung.

Nicht weniger als 36.000 Preußen unter der Führung des Großherzogs von Mecklenburg-Schwerin marschierten in Oberfranken ein (davon 12.000 in Bayreuth). Der Bayreuther Stadtrat stellte fest, dass die Zahl aller Truppen in Oberfranken viel zu gering sei, um einen erfolgreichen Kampf zu führen. Allerdings gab es ein (durch Missverständnisse und Unerfahrenheit entstandenes) Scharmützel in der Nähe von Ottmannsreuth, das sich zum Debakel für die Bayern entwickelte:
Eine falsche telegrafische Depesche (die Umstände sind noch immer ungeklärt) von einem angeblich bereits erfolgten Waffenstillstand zwischen Preußen und Bayern veranlasste ein bayerisches Reserve-Bataillon, von Kemnath Richtung Bayreuth zu marschieren, um sich hier einzuquartieren. Doch die Vorhut, die mit dem Zug aus Creußen unterwegs war, wurde von einem Bahnwärter hält den Zug auf offener Strecke an. Mit einer roten Fahne in der Hand und einer beunruhigenden Nachricht: Die Preußen seien schon da und hätten weiter vorn bereits die Gleise aus dem Schotterbett gerissen.
Ein Bahnwärter war dem herankommenden Zuge der Eisenbahn eine Strecke entgegengelaufen und hatte die Bayern gewarnt; die Kompanie verließ daher rasch die Wagen und stellte sich hinter dem Bahndamm auf die Straße, etwa 300 Schritte von dem Punkte, an welchem die Ostbahn die Straße nach Kemnath durchschneidet. Bald darauf kam das Gros des Bataillons auf der Kemnather Straße anmarschiert und vereinigte sich mit den auf der Ostbahn vorausgeeilten Waffenbrüdern.
Preußische Truppen, die am 28. Juli nachmittags kampflos in Bayreuth einmarschiert waren, „überfielen“ daraufhin das Reservebataillon, so dass die königlich-bayerischen Krieger fliehen mussten. Am 29. Juli, einem Sonntag, holten die Preußen die Bayerischen Truppen bei der „Petzelmühle“, nahe Seybothenreuth ein. Es kam zum Kampf, bei dem fünf bayerische Soldaten starben. Viele Bayern, so ein Augenzeugenbericht, wurden gefangen genommen. Einige Hundert Mann konnten sich zu Fuß nach Creußen retten, indem sie Waffen, Tornister und andere schwere Sachen einfach wegwarfen und die Beine in die Hand nahmen. Nach Versorgung der Wunden fuhren die meisten in einem Zug nach Weiden und kamen damit außer Reichweite der Preußen.
Am 29. Juli 1866 fand in der Endphase des Deutschen Krieges am Goldhügel ein Gefecht zwischen einem Bataillon des bayerischen Leib-Regiments und einem aus Teilen des preußischen 4. Garde-Regiments, des mecklenburgischen Dragoner-Regiments und eines mecklenburgischen Infanterieregiments zusammengesetzten Verband statt. Vom bayerischen Bataillon gelang nur einem Rest von 300 Mann der Rückzug. Durch Verwundung verloren die Mecklenburger einen Offizier und 14 Dragoner und die Preußen einen Füsilier. Auf bayerischer Seite gab es drei Tote (beerdigt in Birk) und 46 Verwundete. Vier bayerische Offiziere und 210 Mann gingen in Gefangenschaft.[5] Zur Erinnerung wurde 1875 am Denkmalweg ein Gedenkstein errichtet.
Katalog_Nord_gegen_Sued_onlinehttp://www.lexikus.de/bibliothek/Die-mecklenburgischen-Truppen-in-Bayern-im-Sommer-1866
https://www.komoot.de/highlight/545780
Chaussee Bayreuth – Pegnitz
Im 18. Jahrhundert baute man in Deutschland erstmals seit der Römerzeit wieder in großem Umfang Fernstraßen. Diese Kunststraßen wurden nach dem französischen Pendant auch Chausseen genannt. Der Bau der Poststraße Bayreuth – Pegnitz – Nürnberg, die direkt an Ottmannsreuth vorbeiführt, fand von 1787 bis 1792 (?) statt (Quelle: StABa, preußisches Fürstentum Bayreuth, Kgl. preußische Regierung, Nr. 163). Sie folgte der schon im frühen Mittelalter, zur Zeit Heinrich I. bezeugten „Via Imperii“, der uralten Handelsstraße von (Rom -) Venedig – Verona – Innsbruck – Augsburg – Nürnberg – Plauen – Leipizig – Stettin (- Königsberg). Im 20. Jahrhundert wurde daraus die Staatsstraße 100, ab 1932 die Reichsstraße 2 von Mittenwald nach Stettin (und später Danzig). Heute ist es die Bundesstraße B2.

Entlang der Chausseen standen in regelmäßigen Abständen Meilensteine, die in Süddeutschland Stundensäulen genannt wurden. Im Bild sieht man eine Stundensäule aus dem späten 18. Jahrhundert, die an der alten Handelsstraße von Bamberg nach Bayreuth (heute B22) am westlichen Ortsausgang von Eckersdorf bei Bayreuth steht.
Die Stunde stand hier aber nicht für einen Zeitraum, sondern diente als Entfernungsangabe:
1 bayerische Poststunde = ½ bayerische Postmeile = 3,7075 (französische) Kilometer
Zwischen zwei Stundensäulen befanden sich sieben Stundensteine. Diese waren kleiner und teilten die Wegstrecke in acht gleiche Abschnitte.

Im Reisehandbuch „Wegweiser durch Bayern“ von 1838 finden sich in Abschnitt 42 die Entfernungsangaben von Bayreuth nach Creußen in ganzen und achtel Stunden.
Im Jahr 1872 wurde schließlich das metrische System eingeführt.
Der Stein, der sich an der B2 am Ortseingang von Ottmannsreuth befindet, ist allerdings kein alter Chausseestein, sondern wurde als Grenzsäule der Stadt Bayreuth im Jahr 1939 errichtet.

Damals folgte die Reichsstraße 2 noch stärker dem ursprünglichen Verlauf der Chaussee; erst um 1970 fand ein großzügiger Ausbau der B2 statt. Auf der Karte sieht man den alten und neuen Streckenverlauf, große Änderungen gab es bei Neuenreuth und in Wolfsbach. Bei Krugshof wurde die Strecke begradigt, der alte Verlauf ist heute ein Parkplatz.
Die Karte zeigt auch Veränderungen in Ottmannsreuth gegenüber der Uraufnahme aus dem 19. Jahrhundert. Zwei der sechs ursprünglichen Höfe sind aus der Senke beim alten Schulweg verschwunden; statt dessen finden sich zwei neu errichtete weiter oben (Freiberger Nr. 2, Mayer Nr. 3). Ferner sind zwei neue Häuser hinzugekommen: Das Forsthaus Kamerun mit der Nummer 7 und das erste Haus in der „Siedlung“ mit der Nummer 8 (Verwandtschaft mit Haus Nr. 5). Der alte Hohlweg (neben der Zufahrt zu Nr. 4) ist ebenfalls nicht mehr eingezeichnet, er wurde als Zugang zur alten Nr. 3 nicht mehr benötigt. Allerdings wird erzählt, dass ihn noch 1945 amerikanische Panzer benutzt haben sollen.
Doch zurück zur alten Chaussee Bayreuth – Pegnitz. Neben den Stundensäulen prägten auch die Chauseehäuschen das Bild dieser Straßen. Die Chausseewärter beaufsichtigten ihren Streckenabschnitt und kassierten das Chausseegeld. Mitunter waren neben diesem Wegezoll auch andere Zollgebühren zu entrichten.

In einem Leserbrief an das „Journal von und für Franken“ beklagt sich ein anonymer Schreiber im Jahre 1791 über die „Prellerey“ entlang der Chausseen:
Da die Ottmannsreuther Bauern selbst im 19. Jahrhundert noch Frondienste für das Hospitalstift zu leisten hatten, dazu aber zwangsläufig die Chaussee benutzen mussten, strengten sie eine Klage an:
Im Jahr 1978 wurde Wolfsbach nach Bayreuth eingemeindet. Dabei wurde die frühere eigenständige Gemeinde nach einem regelrechten Tauziehen dreigeteilt. Wolfsbach, der Krugshof und die Schlehenmühle kamen zu Bayreuth, die Orte Schamelsberg, Bühl und Hühl zur Gemeinde Emtmannsberg, während Ottmannsreuth, Neuenreuth, Eimersmühle und Kamerun seither zum Stadtgebiet von Creußen gehören.
Kamerun
Auf dem Weg von Bayreuth nach Creußen fällt jedem dieser gelbe Wegweiser ins Auge: Kamerun?!

Das Ottmannsreuther Forsthaus Kamerun (Hausnummer: Ottmannsreuth 7) wurde laut Inschriften im Sandsteinkeller im Jahr 1848 erbaut (Quelle: Webseite Forsthaus Kamerun). Die Geschichte des Namens ist interessant:
Es war an einem Sommertag des Jahres 1884, als Fritz Brandt, Technischer Leiter der Festspiele und verlobt mit Cosima Wagners ältester Tochter Daniela, und sein Mitarbeiter und Freund Friedrich Kranich bei einem Ausflug mit ihren Hochrädern zufällig das Forsthaus von Ottmannsreuth entdeckten. (Die gut ausgebaute Chaussee von Bayreuth nach Creußen, heute die B2, erlaubte die gefährliche Fortbewegung auf Hochrädern.) Die Frau des Waldaufsehers trat aus der Tür und lud sie ein, am Tisch im Freien Platz zu nehmen; sie werde ihnen gerne eine Erfrischung bringen. Ganz dem Frieden und Zauber der Umgebung verfallen ließen sie sich nieder. „Eine richtige Entdeckung haben wir da gemacht“ rief Brandt aus. „Ja, wie der Nachtigal in Afrika!“ vollendete Kranich.
Nach einem Zeitungsartikel vom 10./11. August 1957
Mit diesen Worten schilderten sie auch abends nach der Rückkehr ihr Erlebnis. Und da gerade alle Zeitungen von der Hissung der deutschen Flagge in Kamerun berichteten, nannten die beiden Entdecker ihr Forsthaus „Neu-Kamerun“ – und diesen Namen hat es bis auf den heutigen Tag behalten.
Durch die Empfehlung von Brandt und Kranich („Dort ‚ka ma ruhn'“) wurde das Forsthaus ein immer größerer Anziehungspunkt für die Mitwirkenden der Festspiele. Dem Waldaufseher gelang es, eine Wirtschaftskonzession unter dem Namen „Kamerun“ zu beantragen.
Inzwischen war Friedrich Kranich der Nachfolger Fritz Brands geworden. Unter ihm beaufsichtigte Schreinermeister Carl Zimmermann die Gruppe der 120 Bühnenarbeiter des Festspielhauses. Er brachte seit 1885 in jedem Herbst seine Frau Elise und die vier Buben zur Erholung nach Kamerun. Im Laufe der Zeit wirkte es sich nun immer unangenehmer aus, dass bei schlechtem Wetter Frau und Kinder in der rauchigen Wirtsstube der Waldschenke sitzen mussten. Deshalb baute Zimmermann im Jahre 1896 an den Abhang ein schlichtes Holzhäuschen, groß genug um auch Freundesbesuch aufzunehmen.
Mancher Ruhetag zwischen den anstrengenden technischen Arbeiten galt dem Besuch von Kamerun und dem neuen Gartenhause. Da beschloss Prof. Max Brückner, der Maler aller Bühnenbilder seit 1876, Frau Elise Zimmermann eine besondere Freude zu machen. Im Malersaal des Festspielhauses warf er mit genial sicherer Hand Motive zum Thema „Kamerun“ auf die Leinwand: Ein Löwenpaar vor seiner Höhle, Reiher und Papageien, Fasanen und Kakadus, durch Ranken exotischer Blüten und Früchte eingefasst. Mit diesen Bildern wurden nun Rückwand und beide Seitenteile des Gartenhauses verkleidet. Sein Erbauer brachte über der Tür die Inschrift an: „Elisens Hütte / 1896“.
Vor allem während der Proben- und Festspielzeit der nächsten Jahre beherbergte das Gartenhäuschen unterschiedliche Gäste. Am ersten Maisonntag 1898 erschien ein besonderer Besucher: Cosima Wagner, mit ihren beiden Töchtern von Neuenreuth „am Saume des Waldes im Maintal“ entlang kommend, ruhte im Gartenhäuschen aus und sah sich von den „merkwürdig guten Fresken“ begrüßt. „Ich erfuhr, daß unser Dekorationsmaler Brückner sie dort für Frau Zimmermann, unsere Schreinermeisterin, gemalt hatte“, schrieb sie an Freunde.
Nach einem Zeitungsartikel vom 10./11. August 1957

Jahrzehnte später wurden die Gemälde leider versehentlich durch einen in der Hütte nächtigenden Gast der Familie in Brand gesteckt.
Das Ottmannsreuther Forsthaus, auch Kamerun genannt, mitten im Walde gelegen, ist ein Plätzchen, geschaffen für reinsten Naturgenuss; für gute Erfrischungen ist stets gesorgt. Von Bayreuth aus nach dorthin ist folgenden Weg zu empfehlen: Auf der Konnersreutherstrasse biegt man beim Kreuzstein links ab […] geht über Maiernreuth durch das unvergleichlich schöne Bodenmühltal bis zur Schlehenmühle und erreicht von da in 20 Minuten Ottmannsreuth; auf dem Rückwege geht man über Krugshof nach Neu-Bukoba, beliebter Ausflugsort der Bayereuther, eine hübsche Sommerwirtschaft in reizender Lage.
Praktisches Handbuch für Festpielbesucher, 1901, Hrsg. Friedrich Wild
Cosima Wagner
Neben Kamerun erwähnte Cosima Wagner auch Ottmannsreuth in ihren Tagebüchern:
Nachmittags bestimmt R. eine Fahrt nach dem Ottmannsreuther Forsthaus, herrliche Lagerung im Wald auf dem Moose nach einem schönen Spaziergang; […]
Gegen 6 Uhr fahren R., die Kinder und ich nach Ottmannsreuth; schöner Abend. Wir gehen zu Fuß über die Wiese bis nach Wolfsbach, bei schönem Sonnenuntergang, und freuen uns dieses Ausganges und der Heimfahrt sehr; […]
Cosima Wagner, Die Tagebücher 1878-1880, Seiten 116, 375
Am Notenpult der Liefervertrag gez. Cosima Wagner: